

Kontakt: schulzhoosdieter@gmail.com
Nach Abitur und Studium führten mich Neugier, Zufälle und Beharrlichkeit zuerst zum Bau von Segelbooten, dann zum Flugzeugbau und schließlich zu Fragen an die Physik, die mich bis heute begleiten. Einige dieser Fragen stelle ich hier vor – weil ihre Antworten manchmal unerwartet sind.
Aus der Idee, ein einfaches und robustes Segelboot zu bauen,
entstanden mehrere Konstruktionen und Bauweisen. Die aktuellste mit
Paulownia-Holz.
Mehr zum
Bootsbau.
Die Entwicklung der Boxwing-Form und die Versuche, ihre
aerodynamischen Vorteile nachzuweisen, gehören zu meinen
umfangreichen Projekten.
Mehr
zum Boxwing-Projekt
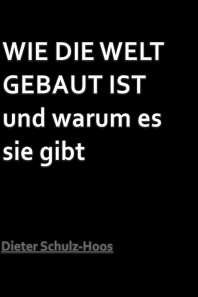
Medizinische Hypothesen
Meine Arbeiten zu Normaldruckhydrozephalus (NPH) und zur Hörtheorie finden Sie hier:
https://github.com/schulzhoosdieter-tech/NPH-Hypotheses
Diese medizinischen Hypothesen wurden aus inhaltlichen Gründen von den physikalischen Arbeiten zum ELEA-Modell getrennt.
Der Weg der Irrtümer
Wer den Eindruck hat, wissenschaftlicher Fortschritt sei ein geradliniges Aufeinanderfolgen von Einsichten, die sich wie Glieder einer Kette sauber aneinanderfügen, der irrt bereits in der Grundannahme. Der eigentliche Weg der Erkenntnis ist der Weg der Irrtümer, und die wenigen Resultate, die wir heute als gültig ansehen, sind nur das übriggebliebene Sediment eines gewaltigen Stromes von Fehlversuchen, Sackgassen und verworfenen Ansätzen.
Einstein wäre kein Einstein geworden, wenn er nicht tausendfach Gleichungen aufgeschrieben und ebenso tausendfach wieder zerknüllt hätte, weil sie nicht trugen, nicht passten, nicht weiterführten. Das Genie bestand nicht darin, gleich die richtige Lösung parat zu haben, sondern darin, die Irrtümer auszuhalten, sie produktiv zu machen, sie so lange gegeneinander zu reiben, bis ein Gedanke entstand, der sich nicht mehr verwerfen ließ.
Man stelle sich die Zeit vor, in der die Relativitätstheorie entstand: Droschken auf den Straßen, Pferdeäpfel im Rinnstein, Gaslicht in den Wohnungen. Inmitten dieses Alltags die gedankliche Kühnheit, Raum und Zeit als veränderlich zu denken, nicht als starre Bühne, sondern als Teil des Spiels selbst – und dies in einer mathematischen Sprache, die erst durch vielfache Fehlschläge geschärft wurde.
Wer sich heute auf den „Erfolg der Großen“ konzentriert, sieht die Kisten voller haarsträubender Irrtümer nicht, die dem Erfolg vorausgingen. Doch ohne sie gäbe es keine Stabilität im Gebäude des Denkens. Denn das, was übrigbleibt, ist nicht das, was einmal „erfunden“ wurde, sondern das, was nach hundertfacher Prüfung, Verwerfung und Selbstkritik nicht mehr zerstörbar scheint. Kurz gesagt: Der Irrtum ist nicht das Gegenteil der Erkenntnis, sondern ihr notwendigstes Werkzeug.
Beim Gähnen geht es nicht etwa darum, bei Schläfrigkeit vermehrt
Sauerstoff zuzuführen, sondern die zugehörige Bewegung der Kiefer
öffnet bei Wirbeltieren, auch beim Menschen, die eustachsche Röhre, die
von der Mundhöhle zum Mittelohr führt. Die Folge:
Das Mittelohr wird belüftet und ein möglicher Druckunterschied zwischen
Mittelohr und Atmosphäre, der das Hörvermögen deutlich beeinträchtigen
kann, wird ausgeglichen.
Gähnen ist also eine Schutzfunktion, denn Mensch und Tier hören nach dem Gähnen mögliche Gefahren besonders gut - obwohl sie schläfrig sind und/oder tagträumen! Das gilt auch für eine Gruppe. Und so, als Schutzfunktion betrachtet, ist es verständlich, dass das Gähnen "ansteckend" ist, denn es erhöht den Schutz einer Gruppe. Für eine Deutung des Gähnens als eine nicht beachtete Schutzfunktion spricht auch:
Bei Dauerstress, der den Körper in einen Zustand versetzt, so als
wäre er ständig von einer oder mehreren Gefahren bedroht (auch eine
strenge Diät zählt dazu), werden Fettzellen neben der eustachschen
Röhre abgebaut und öffnen diese dauerhaft für einen verbesserten
Druckausgleich. Das ist eher unangenehm, denn die eigene Stimme hallt
im Ohr wie im "Hallenbad".
Befragen Sie mal ein mager gehungertes Mannequin zur
"Mannequin-Krankheit des Ohrs" (07.01.2015)
Zum Specht
Manchmal ist man erstaunt. Etwa, wenn ein Experte im Fernsehen auf die Frage, warum der Specht sich nicht beim Trommelhacken das Gehirn schädigt, erklärt: "Da gibt es viele Gründe, der wohl wichtigste aber ist, dass der Specht eine starke Halsmuskulatur besitzt, die den Aufprall dämpft". Die tatsächliche Antwort ergibt sich aus der "Trägheit der Masse" und einer elastischen Aufhängung. Stellen sie sich ein Bleikugel - vielleicht 1 cm Durchmesser - in einem Holzkästchen vor, wo sie von zwei Spiralfedern, die an der Vorder- und Rückwand des Kästchens befestigt sind, in dessen Mitte gehalten wird. Sind Masse und Federeigenschaften bekannt, so kann man errechnen, bei welcher Frequenz, bei welcher wiederholter abrupter Vor- und Rückbewegung des Kästchens, die Kugel völlig unbeteiligt bleibt und in der Mitte des wechselnd beschleunigten Kästchens ruht. Der Specht rechnet zwar nicht und sein Gehirn hängt auch nicht an Federn, aber auch für dieses System kann man eine Frequenz ausrechnen, bei der das Spechthirn trotz Hämmern des Kopfes mit dem Schnabel völlig unbeteiligt in der flüssigkeitsgefüllten Schädelkalotte ruht. Der Specht erhält dieses Frequenzwissen über seine Gene und erfühlt die für ihn passende exakte Frequenz. Und er hämmert daher nicht mit allen ihm möglichen Frequenzen, sondern immer nur mit derjenigen, bei der sein Gehirn flüssigkeitsgedämpft in der Schädelmitte unbeteiligt ruht. Falls Sie das nicht glauben wollen, fragen Sie einen Specht oder einen Physiker. (05.03. 2016)
Zur Zugvogelformation
Größere Zugvögel fliegen oft in einer Keilformation. Ein Vogel bildet die Spitze, die anderen fliegen dahinter in folgender V-Formation: >. Die Begründung der Wissenschaft: Von den Flügelspitzen des jeweils vorfliegenden Vogels gehen langgezogene Tütenwirbel ab, die nach innen rotieren. Auf deren Außenseite existiere daher ein Aufwindgebiet, das der nächste Vogel nützen könne, um energiesparend in diesem Aufwind zu fliegen. Energieerspanis 10 – 15 %.
Nimmt man zwei gleich große Sportflugzeuge und versucht, diesen Effekt in der Praxis einmal nachzuvollziehen, so stellt man schnell fest, dass das Aufwindgebiet viel zu klein ist, um das gesamte nachfliegende Flugzeug zu erfassen. Man bekommt gerade einmal eine Fläche in den Aufwind und kippt ab, wenn man nicht gegensteuert und dann verlustreicher fliegt als ohne den Aufwind auf der äußeren Tütenwirbelseite. Und das gilt letztlich auch für Vögel:
Es gibt kein ausreichendes Aufwindgebiet am Tütenwirbel eines vorfliegenden Flügels, das ein nachfliegender Vogel nützen könnte. Und schon gar nicht, wenn der vorfliegende Flügel ein Schlagflügel ist, der einen schwingenden Tütenwirbel erzeugt und hinter sich her führt. Eben deshalb traue der Erklärung der Naturwissenschaft für die Keilflugformation der Zugvögel nicht über den Weg. Meine eigene und anders begründete Erklärung:
Jeder rotierende Wirbel (hier Tütenwirbel) bezieht seine Rotationsenergie vom Flugzeug oder Vogel, was sich an diesen als Widerstand bemerkbar macht. Verringert man diesen Widerstand, indem man dicht über dem Boden fliegt, wo die Rotation der Tütenwirbel durch Reibung am Boden gebremst wird, verringert sich der Widerstand des Flugzeugs deutlich und es fliegt zudem mit einem besseren effektiven Anstellwinkel. Das Ganze nennt man Bodeneffekt und startende/fliegende Wasservögel fliegen daher so dicht über der Wasseroberfläche, dass die Flügelspitzen, von denen die Tütenwirbel abgehen, fast das Wasser berühren. (Mit "Staueffekten" hat dieser Bodeneffekt bei schlanken Flügeln nichts zu tun.)
Fliegen nun Vögel in Keilform hintereinander und stören auf diese
Weise die Wirbelschleppen des ersten Vogels vorteilhaft wie bei einem
Bodeneffekt, dann fliegt dieser erste Vogel wesentlich energiesparender
als die Vögel hinter ihm. Die Spitze des Keils ist daher die
energiesparendste „Königsposition“, weshalb man sie zugunsten der
anderen Vögel immer wieder wechselt.
Doch die "Hintermänner" gehen nicht leer aus, denn durch den Flügelschlag der "Vordermänner" entsteht ein "schwingender" Abwind. Für den nachfolgenden Vogel entsteht daraus jeweils eine wellenförmige Anströmung. Und in einer wellenförmigen Anströmung fliegt ein Flügel deutlich widerstandsärmer - der sog. Katzmayr-Effekt. Deswegen fliegen Zugvögel in einer Ebene und so, dass sie jeweils hinter einem schlagenden Flügel fliegen, weil das ihren Widerstand verringert.. Überprüft wurde der Katzmayr-Effekt ohne Wollen, als man in Russland erstaunt feststellte, dass Tragflügelboote bei bestimmten Wellen und dazu diesen gefahrenen Kursen wesentlich weniger Anriebsleistung zum Erhalt der Geschwindigkeit benötigten als auf anderen Kursen. Meine Meinung:
Durch die Keilflugform nutzen Zugvögel die geschilderten Effekte und nicht etwa einen Auftrieb an der Seite der Hauptwirbel, die von einem Flügel abgehen! Das ist eine Theorie, die sich in der Praxis nicht nachvollziehen lässt. Wollen Sie eine weitere Meinung dazu einholen, dann befragen Sie eine Graugans. (1.2017)
Zum Klebstoff im Kopf?
Sind Parkinson und Alzheimer "Milieuschäden"? Parkinson gilt gemeinhin als Dopamin-Mangel-Krankheit. Dopamin ist ein Stoffwechselprodukt von sogenannten Dopamolekülen und fungiert dann als wichtiger Neurotransmitter im Gehirn. Parkinson-Kranke haben vermutlich zu wenig davon, denn die Gabe von L-Dopa, der Vorstufe des Dopamins hilft, ein bisschen, sagt man. Und jetzt kommt's:
Bekannt ist schon seit längerer Zeit, daß die Miesmuschel sich mit Hilfe solcher Dopa-Moleküle an organische und anorganische Stoffe heften kann. Bei derjenigen Form des Dopa-Moleküls, die sich auch mit organischen Stoffen verbindet, gibt es allerdings eine erstaunliche Besonderheit: Das Molekül entwickelt seine extrem klebende Eigenschaft nur in einem bestimmten Milieu, bei der Miesmuschel ist es z.B. ein Salzwasser mit einer gewissen Mindestkonzentration. Sonst nicht!
Könnte es somit sein, dass der Mangel an Dopamin bei den Parkinsonkranken eine mittelbare Folge davon ist, dass das fluide cerebrale Milieu bei ihnen gegenüber dem Gesunden osmolytisch in Richtung höherer Konzentration verschoben ist und dass der Dopamin-Mangel auf einem plaquebildenden Hafteffekt der Dopa-Vorstufe beruht? Nachdenken könnte man darüber auf berufener Seite einmal! Vielleicht entdeckt man dann auch gleich mit, über welche Induktionen die Plaque-Bildung bei der Alzheimer-Demenz erfolgt. Bei jener Krankheit also, die uns mit hoher Wahrscheinlichkeit in Vielzahl ereilt, wenn wir nur alt genug für sie werden. Mit jetzt aktuell 60 Jahren macht man sich da so seine Gedanken. (15.01.2011)Suchbegriffe: Dieter Schulz-Hoos · ELEA-Modell · Interpretation Einsteins · Energie als Schnitt · Trägheit als Raumstruktur · Gravitation ohne Masse · Signalträgheit · Normaldruckhydrozephalus · Wo bleibt die Zukunft? · gute-schreibe.de · sunny-boxwing.de